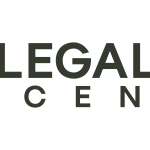Um von Bafög-Anträgen nicht überfordert zu werden, haben Philip Leitzke, Alexander Rodosek und Pascal Heinrichs während ihres Studiums das Legal Tech-Startup meinBafög gegründet. Der meinBafög-Antragsassistent hilft Studierenden und Azubis innerhalb von 30 Minuten, ihren BaföG-Antrag online zu erstellen. Das Startup hat sich mittlerweile zur Access 2 Justice UG weiterentwickelt und plant fleißig, weitere komplexe Anträge zu digitalisieren. Im Interview mit mkg-jura-studis.de verrät Mitgründer Philip Leitzke, welche Fehler sich bei der Gründung eines Legal Tech-Startups vermeiden lassen – und wie man ein Legal Tech-Startup überhaupt gründet.
Lieber Philip, wie seid Ihr dazu gekommen, das Legal Tech-Startup „meinBafög“ zu gründen?
Philip Leitzke: Wir hatten die Idee zu meinBafög zu Beginn unseres Studiums, als wir uns selbst mit dem Thema Studienfinanzierung und BAföG auseinandergesetzt haben. Der zündende Gedanke kam damals von Pascal, der vor seinem BAföG-Antrag saß und sich gefragt hat, warum das Ganze nicht digital und einfacher geht. Wir drei hatten alle gerade eine Ausbildung im IT-Bereich abgeschlossen und waren überzeugt davon, dass man hier etwas bewegen und für viele Studierende deutlich verbessern kann. Heute können wir uns über stetig wachsende Nutzerzahlen freuen!
Euer Team besteht größtenteils aus Leuten, die eher im IT- oder Management-Bereich ausgebildet wurden – wie viel juristisches Fachwissen musstet Ihr Euch im Zuge der Gründung aneignen oder vermitteln lassen?
Philip Leitzke: Das stimmt, jeder von uns drei Gründern hatte zu Beginn hauptsächlich den IT- und Wirtschafts-Background. Mit Alex haben wir aber das große Glück, einen Wirtschaftsrechtler im Team zu haben. Da er für diese juristischen Themen brennt, konnten wir die Plattform ohne weitere Unterstützung von außen konzeptionieren. Trotzdem war der Aufwand der Einarbeitung enorm, da auch Pascal und ich bei den Konzepten mitgewirkt haben und wir uns ebenso mit der juristischen Seite des Themas befassen mussten. Später, als die Plattform schon eine Weile lief, aber auch immer weitergewachsen und komplexer geworden ist, haben wir uns Hilfe von außen dazu geholt und die Richtigkeit unseres Antragsassistenten und des BAföG-Rechners bestätigen lassen.
Von wem habt Ihr Euch die Richtigkeit der beiden Tools bestätigen lassen?
Philip Leitzke: Das Problem ist, dass es so gesehen keinen Fachanwalt für BAföG gibt. Es gibt natürlich Anwältinnen und Anwälte für Hochschulrecht, was aber nicht zwingend heißt, dass sie sich mit dem im Sozialgesetz angesiedelten BAföG auskennen. Wenn man ein bisschen sucht, findet man trotzdem den ein oder anderen Juristen, der bereits viel Erfahrung im Bereich BAföG hat. Zum einen haben wir also eben genau diese AnwältInnen konsultiert – vor allem natürlich in Detailfragen, zu denen wir gerne mehrere Meinungen gehört hätten.
Wir haben aber auch immer wieder Rücksprache mit diversen Ämtern oder auch mit dem größten Studierendenwerk in Deutschland, dem Kölner Studierendenwerk, gehalten. Gerade dort liegt natürlich die Expertise in der Abwicklung und Auswertung der BAföG-Anträge. Wir konnten so neben der rein juristischen Perspektive auf das Thema auch noch ein paar Einblicke in den Ablauf beim Amt bekommen. Das hat zwar keinen Einfluss auf die Art und Weise wie wir entwickeln, da der oder die Studierende unser Kunde ist – wertvolles Feedback bezüglich der Korrektheit der Anwendung bekommt man so aber auf jeden Fall.
Wie wurden IT-Kenntnisse und juristisches Wissen bei der Entwicklung der Tools zusammengebracht, also das interdisziplinäre Arbeiten bei Euch organisiert?
Philip Leitzke: Im Grunde durch engen Austausch und dem Aufteilen des Entwicklungsprozesses in unterschiedliche Phasen. Neben dem reinen Aussehen unserer Plattform ist der Kern die Logik und das Abarbeiten von Entscheidungsbäumen. Bevor irgendwas von dieser Logik wirklich implementiert werden kann, müssen die Konzepte sehr ausgereift sein, sonst entwickelt man und muss im Worst Case den Großteil des Codes wieder wegschmeißen.
Wir hatten also eine Konzeptionsphase, in der auch alle im Team mit Teilaufgaben eingebunden waren. So konnte Pascal als Entwickler beispielsweise schon ein besseres Verständnis von den juristischen Aspekten erarbeiten, während Alex durch Pascals Feedback auch technische Aspekte besser verstehen und berücksichtigen konnte. In der Entwicklungsphase haben wir alle die Anwendung auch getestet, einmal auf Funktionalität, aber natürlich auch auf Sinnhaftigkeit, Schlüssigkeit und Zugänglichkeit für die Nutzerin oder den Nutzer. Auch dadurch entstehen wieder Feedbackschleifen in beide Richtungen, von Alex als Jurist zu Pascal als Entwickler und umgekehrt.
Bei Jurastudierenden ist es – wahrscheinlich im Gegensatz zu Euch – eher so, dass unternehmerisches Denken und eine „Probier-Mentalität“ nicht unbedingt im Studium vermittelt werden. Was würdet Ihr Jurastudierenden raten, die trotzdem darüber nachdenken, ein eigenes Legal Tech-Startup zu gründen?
Philip Leitzke: Meiner Meinung nach lernt man im Studium zu lernen, also sich selbst mit noch unbekannten Themen zu beschäftigen und sich Wissen anzueignen. Durch das Internet ist es heute so einfach wie noch nie, sich Wissen anzueignen. Sehr viel Wissen rund um Unternehmertum, wie man eine Firma organisiert, wie man intelligent wirtschaftet und wie man die Arbeit strukturiert, ist digital verfügbar und nur einen Klick entfernt. Es gibt Bücher, E-Books, Podcasts, Blogs, Vlogs und viele schon erfolgreiche Unternehmen sind beispielsweise auf Plattformen wie LinkedIn sehr transparent mit Best Practices. Bücher, die ich empfehlen kann, sind beispielsweise „Zero to One“ von Peter Thiel oder auch „Lean Startup“ von Eric Ries und bei den Podcasts beispielsweise den OMR-Podcast von Philipp Westermeyer.
Wer sein Jurastudium gemeistert hat, sollte beispielsweise mit Buchhaltung auch keine Probleme mehr haben. Was die Probier-Mentalität angeht: Seid mutig! Gerade wenn man schon eine konkrete Idee hat und daran glaubt, sollte man einfach loslegen, am Ball bleiben und auch keine Angst vor Fehlern haben. Idealerweise lernt man aus den Fehlern und man merkt schnell, dass nicht jeder kleine Fehler das Vorhaben zum Scheitern verurteilt.
Gibt es typische Fehler, die sich bei der Gründung eines Legal Tech-Startups vermeiden lassen?
Philip Leitzke: Ich hoffe, dass wir nicht allzu viele Fehler gemacht haben, bisher läuft es ja ganz gut. Zu Anfang ist die Wahl der Unternehmensform sicherlich wichtig. Dazu lohnt es auch, sich ein bisschen mit Steuerrecht auseinanderzusetzen. Darüber hinaus sollte man nicht zu unflexibel sein. Man startet mit einer Idee und hat gewisse Vorstellungen, während der Umsetzung der Idee kann man aber feststellen, dass einige Aspekte der Idee so nicht funktionieren.
In solchen Fällen sollte man nicht zu lange an der ursprünglichen Idee festhalten, meistens führen viele Wege nach Rom und zum Erfolg. Zusätzlich ist es immer gut, auf seine Kunden zu hören und sich auch früh Kunden-Feedback einzuholen, idealerweise bevor die Idee komplett fertig umgesetzt ist. Wobei „komplett fertig umgesetzt“ vermutlich ohnehin ein Status ist, der nie eintritt, womit der letzte Fehler für mich Perfektionismus ist. Soll nicht heißen, dass man nicht versuchen sollte, das für den Kunden bestmögliche Produkt zu entwickeln. Irgendwann möchte man aber natürlich Geld verdienen, meistens eher früher als später. So kann man seine Idee auch früh auf die Probe stellen und die Punkte, die noch nicht optimal laufen, verbessern – denn ein solcher Praxistest kommt auch mit der bestmöglichen Vorbereitung auf einen zu.
Welche Entwicklungen plant Ihr als nächstes in Eurem Legal Tech-Startup?
Philip Leitzke: Als nächstes müssen wir unsere Plattformen weiter ausbauen und verbessern. Neben kleinen Features, die unsere Plattform noch nutzerfreundlicher machen, gibt es natürlich auch größere Themen, die uns auf längere Sicht beschäftigen werden. Unser Ziel ist es, den kompletten Antragsprozess digital abzuwickeln, ohne Medienbruch und ohne Drucken. Das ist aktuell nicht möglich, weil für den BAföG-Antrag die Schriftformerfordernis gilt und es auch keine Schnittstellen bei den Ämtern gibt, an die wir die Anträge digital senden könnten. Das Drucken ist bei solchen Anträgen zu unserem Glück der kleinste Schmerz für die NutzerInnen. Trotzdem kann man mit einer Lösung, die Ende-zu-Ende digital ist, natürlich einen großen Mehrwert schaffen. Alleine die Zeiten, die der Schriftverkehr auf dem Postweg in Anspruch nimmt, könnten massiv verkürzt werden und auch Aktualisierungsanträge könnten in Sekunden erledigt werden. Das hätte natürlich auch positive Effekte auf die Antwortzeiten bei den Ämtern – ganz abgesehen davon, dass wir den Ämtern schon jetzt genau kalkulieren können, wie hoch die Förderung für einen Antragsteller ausfällt.
Außerdem stehen schon Ideen für neue Plattformen in den Startlöchern. Neben dem Antrag auf Elterngeld, den wir bereits umgesetzt haben, gibt es viele weitere komplexe Anträge in Deutschland, die noch nicht digitalisiert wurden. Für die Entwicklung von meinBafög.de haben wir damals ca. drei Jahre gebraucht, für dasElterngeld.de waren es nicht einmal mehr sechs Monate. Dadurch, dass wir natürlich Erfahrung dazugewonnen haben und unser Team größer ist, können wir solche Anträge jetzt nochmal in deutlich weniger als sechs Monaten digitalisieren.
Alles in allem haben wir also noch ein paar Hausaufgaben.
Lieber Philip, vielen Dank für Deine Zeit und Deine Antworten!
Das Interview führte Jasmin Kröner.